Julia Schmidt & Himang Choi
Wissenschaftliche Vorträge sind im universitären Kontext für uns Studierende und Forschende keine Seltenheit. Die Aufgabe der kompetenten Darstellung komplexer Zusammenhänge begegnet uns sowohl in Seminarvorträgen als auch der Vorstellung eigener Studien, dem Vortrag eigener Abschlussarbeiten in Kolloquien sowie vielen weiteren Szenarien. Insbesondere weil man die Fähigkeit des Präsentierens auch im späteren Leben – vor allem im Arbeitskontext – benötigt, ist die Professionalisierung dieser Schlüsselkompetenzen von immenser Bedeutung. Nicht nur das Lernen und Lehren, also die Erarbeitung von bestimmten Inhalten und deren Darbietung für ein Auditorium mit Mimik, Gestik und Rhetorik, spielen eine wichtige Rolle beim Präsentieren, sondern auch die Didaktik im Sinne der Wissenschaft des Lehrens und Lernens.
Was wird in diesem Artikel beschrieben?
Für die Planung, Vorbereitung und Darbietung eines akademischen Vortrags gibt es einige Richtlinien und Tipps. Diese gewährleisten, dass alle für ein Thema relevanten Aspekte abgedeckt und sowohl korrekt als auch eingängig dargestellt werden. Im Folgenden werden euch diese Punkte anhand der „Landkarte für eine aktivierende Präsentation” vorgestellt. Diese Landkarte verfügt über folgende inhaltliche Bestandteile, die im Folgenden näher erläutert werden: Den Situationsbezug einer Präsentation, den Präsentationsaufbau, den Medieneinsatz und die (Körper-)Sprache.

Situationsbezug
Unter Situationsbezug versteht man die Anpassung einer Präsentation in Inhalt und Form an ihre situativen Gegebenheiten. Dieser Situationsbezug lässt sich leicht anhand den folgenden drei Schritten der Analyse herstellen: Erstens die Analyse des Anlasses, zweitens die Analyse der Rahmenbedingungen und drittens die Analyse der Zuhörerschaft.
Beim wissenschaftlichen Präsentieren ist klar: Der „Anlass“ ist immer mit der Präsentation von Inhalten oder Forschungsergebnissen verbunden. Diese können entweder innerhalb studentischer Seminare, Kolloquien oder aber auf Tagungen oder Kongressen erfolgen. Damit ist auch klar, dass der Inhalt die Form definieren sollte – und nicht andersherum, so wie dies in anderen professionellen Kontexten der Fall sein kann (Köhler, 2019). Natürlich darf bzw. sollte auch beim wissenschaftlichen Präsentieren eine „Botschaft“ erzählt werden und die Präsentation nicht nur interessant sondern auch kurzweilig sein – jedoch so gut dosiert, dass es dem Anlass, den Rahmenbedingungen und den Zuhörer*innen gerecht wird. Natürlich gibt es zwischen verschiedenen akademischen Anlässen unterschiedliche Bedarfe: Soll eine Präsentation länger als 20 Minuten sein, so sollte sie immer Arten der Zuschaueraktivierung enthalten, da die Aufmerksamkeitsspanne des Publikums dann überschritten wird (vgl. Davis, 2009) – ob eine Aktivierung jedoch in einer Gruppenarbeit, in der Einbettung eines Videos in die Präsentation oder einer Fragerunde besteht, ist anlassbezogen zu entscheiden.
Durch die COVID-19-Pandemie hat sich insbesondere der „Rahmen“ verschoben: Präsentationen laufen plötzlich alle virtuell, der Einsatz von Flipcharts als Präsentationsmedium ist bedeutend erschwert oder gar unmöglich, ohne eine stabile Internetverbindung können Präsentationen nicht gehalten werden, etc. Wenn sich die Rahmenbedingungen vor der Pandemie also eher eine Orientierung an technischer Ausstattung, Raumgröße, Anzahl der Zuschauer*innen, Uhrzeit, etc. orientierten, sind die Bedingungen des digitalen Raumes nun besonders wichtig.
Da insbesondere die Zuhörer*innen als das Publikum der Präsentation ein wichtiger Bezugspunkt ist, wird häufig auch von „Zuhöreranalyse“ gesprochen (Hey, 2018, S.46): Die Auseinandersetzung mit dem Publikum ermöglicht es, Annahmen über das Vorwissen, die Motivation zur Mitarbeit und besondere Eigenheiten der Zielgruppe treffen (Böhringer et al., 2007) – und in Darstellung der Inhalte in ihrer Form an die Vorrausetzungen des Publikums anpassen. Beispielhaft kann das bedeuten, dass ihr eine Präsentation an die verschiedene Personengruppen eines Seminarkontextes anpassen solltet: Sowohl die Dozent*innen als auch die Studierenden haben mitunter konfligierende Erwartungen. Es muss oftmals auch damit gerechnet werden, das einzelne Zuschauer*innen eine zweifelnde oder kritische Haltung einnehmen. Sich dies bewusst zu machen und zu antizipieren, hilft uns bspw. mit kritischen Fragen angemessen umzugehen.
Wenn diese drei Gesichtspunkte erfolgreich durchlaufen und abgedeckt werden, profitiert nicht nur die vortragende Person, sondern auch die Zuhörer*innen. So kann die vortragende Person sich mit der richtigen Planung auf das Publikum und mögliche Fragen oder Einwände einstellen, und ist in der Lage, Unsicherheiten sowie die eigene Nervosität zu reduzieren. Den Zuhörer*innen kommt auf der anderen Seite entgegen, dass ihre Interessen berücksichtigt und somit ein aufmerksames Zuhören und Auseinandersetzen mit der Thematik erleichtert werden.
Teilnehmer*innenaktivierung als Strukturelement einer Präsentation
Während eine typische inhaltliche Gliederung einer wissenschaftlichen Präsentation – bspw. als Tagungsbeitrag auf wissenschaftlichen Konferenzen – meistens die Abfolge von (I) Einleitung, (II) Hypothesen, (III) Methode, (IV) Ergebnisse und (V) Diskussion folgt, wird der inhaltliche Aufbau didaktisch durch „AIDA“ gerahmt. Was aber ist AIDA?
Mit dem Ziel, eine möglichst aktivierende und gut strukturierte Präsentation aufweisen zu können, wird allerdings oft die Präsentationsstruktur AIDA empfohlen und der oben dargestellten, klassischen, eher einfach gehaltenen Gliederung, bevorzugt. Die Präsentationsstruktur AIDA setzt sich aus vier Kernkomponenten zusammen: Aufmerksamkeit, Interesse (15 %), Darstellung (75%) und Abschluss (10%). Böhringer und Kollegen (2007) definieren diese vier Schritte als ein eigenes Gliederungsprinzip, welche aber nicht zwingend chronologisch umgesetzt werden müssen, und beschreiben sie wie folgt:


Die erste Kernkomponente besteht hierbei darin, Aufmerksamkeit zu erregen. Dies kann zum einen durch überraschende Aufhänger wie etwa eine Statistik, ein Zitat oder eine kurze Videosequenz erfolgen. Zum anderen können dafür aber auch optische „Köder“ verwendet werden.
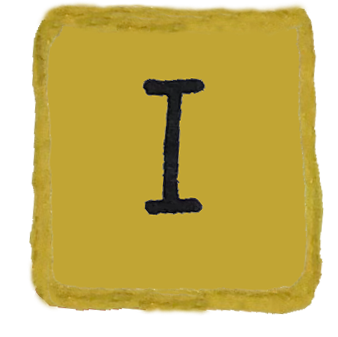
Die folgende, zweite Kernkomponente zielt darauf ab, das Interesse des Publikums zu wecken. Hierbei spielen sowohl die Benennung des Themas als auch des Nutzens für die Zuhörer*innen eine Rolle. Auch die Herstellung des Hörer*inenbezugs, bspw. durch den Verweis auf einen gemeinsamen Wissenshintergrund, ist hier von Relevanz und sollte als Präsentationstool eingesetzt werden.

Die Darstellung des Inhaltes bildet die dritte Kernkomponente ab. Das Ziel besteht dabei in der Verankerung neuer Informationen. Das freie Sprechen des Vortragenden sowie die Aktivierung der Teilnehmenden sind zwei Aspekte, die hierbei als hilfreich gelten.

Die vierte und letzte Kernkomponente ist der aktive Abschluss. Von besonderer Bedeutung ist hierbei die Zusammenfassung der wichtigsten Punkte bzw. die Formulierung einer Take-Home-Message. Die Überleitung zur Diskussion ist ein weiterer Aspekt, der in diese Kernkomponente mit einspielt und nicht fehlen sollte.
Während alle Teilaspekte des AIDA-Modells aktivierende Elemente enthalten, wie rhetorische Fragen, Zwischenfragen, Videoinputs oder besondere Grafiken, o.ä., dient insbesondere die Diskussion unter anderem der Teilnehmer*innenaktivierung: Hier können Teilnehmer*innen aktiv in der Präsentation partizipieren, Fragen stellen und bzw. oder diskutieren. Diese ist von so hoher Relevanz, da die menschliche Aufmerksamkeitsspanne durchschnittlich auf nur 20 Minuten begrenzt ist (Chaney, 2005): Dies gilt für Studierende genauso wie für Lehrende oder Praktiker*innen. Demnach ist es nicht nur empfehlenswert – sondern regelrecht unabdingbar – aktivierende Seminarmethoden nicht nur in die Diskussion, sondern auch zwischen längeren theoretischen Inputs einzubauen. Hierbei geht es darum, soeben aufgenommene Informationen direkt anwenden zu müssen, mit dem Ziel eine tiefgreifende Konsolidierung des Lernstoffes zu bezwecken (Klein, 2010). Aktivierende Seminarmethoden sollten bestenfalls kreativ und effektiv sein und sich dabei in ihrem Mediengebrauch nicht zu häufig wiederholen.
Alle Aktivierungsmethoden (Knoll, 2007; Klein, 2010) sollten bezüglich des Anlasses und Publikums angepasst werden, da sie abhängig von der Situation eine andere Funktion einnehmen und jede Situation nur bestimmte Möglichkeiten der Aktivierung zulässt (Knoll, 2007). Ist die Methode der Teilnehmer*innenaktivierung dem Kontext entsprechend gewählt, kann die gewünschte Wirkung erzielt werden, die Konzentrationsfähigkeit sowie den Lernerfolg deutlich zu steigern (Knoll, 2007).
Medieneinsatz
Das Nutzen von Medien bringt zahlreiche Vorteile mit sich, doch um Medien effektiv einsetzen zu können, muss uns bewusst sein, wozu genau diese Medien dienen und welchen Zweck sie im großen Rahmen der Präsentation erfüllen sollen.
Als das wohl prominenteste Präsentationsmedium ist Microsoft PowerPoint für alle Präsentierenden ein unverzichtbares Werkzeug. Im Folgenden sind einige Do’s und Don’ts für die Nutzung des Programms zusammengefasst. Doch eine goldene Regel gilt fast immer: Weniger ist mehr. Im Zweifelsfall sollte der Medieneinsatz und dessen Gestaltung sparsam gehalten sein, anstatt überladen – denn das Medium soll als Werkzeug den eigentlichen Informationsträger unterstützen und nicht ersetzen oder überlagern (Lammerding-Köppel et al., 2019).
Eine transparente und sinnvolle Struktur der Präsentation, bspw. durch das Einbinden einer Gliederung am Anfang und einem klar erkennbaren roten Faden während des Vortrags, ist für das Aufnehmen und Konsolidieren der Inhalte seitens des Publikums essenziell (Grzella et al., 2018). Folgende Fragen sollten bei der Erstellung einer Präsentation berücksichtigt werden: Ist der Inhalt so gegliedert, dass dieser in Gedanken einfach zu sortieren ist? Welche Teile der Präsentation sind tendenziell noch eher zusammenhangslos? Hierbei ist es hilfreich, nicht nur zu Beginn der Präsentation auf die Gliederung und somit die Struktur einzugehen, sondern diese während des gesamten Vortrags für das Publikum zugänglich zu machen. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Beispielsweise könnt ihr die Gliederung so in die PowerPoint-Präsentation einbetten, dass anhand einer Leiste neben den Präsentationsfolien angezeigt wird, wo man sich gerade in der Präsentation befindet. Alternativ könnt ihr die Gliederung aber auch zuvor mit einem Medienwechsel auf ein Whiteboard, eine Tafel oder Flipchart-Papier schreiben und sie somit für das Publikum durchgängig ersichtlich machen.
Das Foliendesign und das Layout sollten farblich ansprechend, aber einfach gehalten sein, um etwaige Ablenkungen oder Übersättigungen zu vermeiden (Böhringer et al., 2007). Die typische Daumenregel lautet, dass maximal fünf Stichpunkte auf einer Folie zu finden sein sollten. Diese sollten immer aus Schlüsselwörtern bestehen, die für das Verstehen des Inhalts unverzichtbar sind. Auch bei schwierigen Fachbegriffen oder Fremdwörtern ist es hilfreich, diese auf den Folien stehen zu haben – falls sie nicht vermeidbar sind. In dem Fall, dass sich Inhalte nicht in bis zu fünf Stichpunkten abbilden lassen, sollten diese auf mehrere Folien aufgeteilt werden.
Einer der Hauptaspekte der Foliengestaltung ist die Visualisierung (Hey, 2018). Unter der Visualisierung versteht man die Übersetzung eines Gedankens in ein sichtbares Hilfsmittel, um den Informationsfluss zu fördern. Einen Großteil der Informationen nehmen wir visuell wahr. Die Schrift stellt dabei auch eine Form der Visualisierung dar, allerdings muss diese gelesen und kontextabhängig interpretiert werden (Böhringer et al., 2007). Dieser Prozess kostet mehr Energie und ist in der Regel zeitaufwändiger als eine bildlich eindeutige Darstellung. Darum sind einfache und hilfreiche Visualisierungen einzusetzen, wann immer es geht (Hüttmann, 2018). Die PowerPoint Designer-Funktion stellt hierbei ein interessantes Tool dar. Diese Funktion schlägt unterschiedliche Darstellungen für die jeweiligen Folien vor und erlaubt es somit, innerhalb von kürzester Zeit durch grafisch ansprechende Folienlayouts einen professionellen Eindruck zu machen.
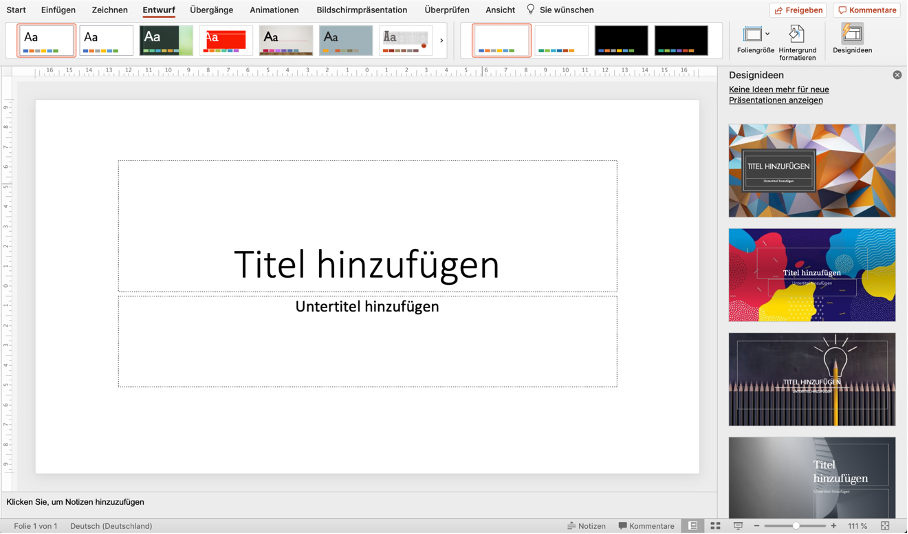
(Körper-)Sprache
Um die Aufmerksamkeit der Zuhörerschaft zu sichern, ist es wichtig, stets Blickkontakt mit dem Publikum zu halten. Dabei solltet ihr den zur Verfügung stehenden Raum nutzen und euch nicht hinter Objekten wie dem Lehrpult oder einem Flipchartständer verstecken. Dieser Raum, auch Bühne genannt, umrahmt die Präsentation und erlaubt die Gestaltung eines lebendigen und klaren Vortrags (Grzella et al., 2018). Als Vortragende*r könnt ihr euch auf der Fläche frei bewegen und verschiedene Stellen des Vortrages von verschiedenen Positionen im Raum aus halten.
Wenn ihr als Referent*in auf einen spezifischen Punkt der Präsentationsfolien hinweisen möchtet, solltet ihr dabei folgende Vorgehensweise beachten: zunächst solltet ihr auf den entsprechenden Punkt deuten, euch dann zum Publikum umdrehen und erst im Anschluss mit der Präsentation fortfahren. Diese Methodik wird „Touch, Turn, Talk“ genannt und gewährleistet, dass ihr während des Vortrags das Sprechen zur Leinwand vermeidet und somit dem Publikum möglichst selten den Rücken zuwendet.
Nicht nur die gesprochene Sprache vermittelt uns Eindrücke, auch die Körpersprache sagt viel (Leow et al., 2013). Man muss Emotionen nicht unbedingt verbal ausdrücken um sie für andere zugänglich zu machen. Viele Emotionen, wie Wut oder Ärger, lassen sich auch direkt aus der Mimik einer Person ablesen (Ekman et al., 1999). Bei einer Präsentation ist es wichtig, dies mit einzukalkulieren. Dabei solltet ihr euch beim Präsentieren stets bewusstmachen, welche Signale ihr durch eure Körperhaltung, Handbewegungen und Mimik an das Publikum sendet.
Um eine angemessene Mimik und Gestik zur Schau stellen zu können, muss erst einmal klar sein, welchen Eindruck ihr vermitteln möchte (Schott, 2019). Häufig wird versucht, Seriosität und Sicherheit auszustrahlen – manchmal auch Sympathie. Dafür bedarf es an Übung und Erfahrung. Die gewünschte Wirkung kann bspw. über die Körpersprache durch das Einnehmen eines klaren Standpunkts erzielt werden. Ein sicherer Stand ist demnach hierbei grundlegend. Schnelle und fahrige Bewegungen wirken schnell hektisch und aufgeregt (Schott, 2019). Obgleich ihr es zunächst als ungewohnt und fremd empfinden mögt, wirkt eine gerade Haltung mit leicht rausgestreckter Brust selbstbewusst und authentisch. Eine gebeugte Haltung dagegen vermittelt augenscheinlich geringe Motivation und fehlende Überzeugung (Lammerding-Köppel et al., 2019). Das freie Sprechen – ohne bspw. eine vorgeschriebene Rede – während einer Präsentation ist zudem wichtig, damit die Hände zum Gestikulieren frei sind (Schott, 2019). Durch die unterstützenden Bewegungen vermittelt ihr als Vortragende*r nicht nur den Eindruck von Kompetenz – die Nutzung illustrierender Gesten machen das Gesagte für das Publikum zudem verständlicher und steigert das langfristige Behalten (Rogers, 1978).
Feedback

Du hast Feedback zu unserer Seite? Dir haben wichtige Punkte gefehlt? Dann schreib uns gerne eine Nachricht!
