Fußnoten und weiße Söckchen
(Kirsten Salein)
Etwa 15 waren es damals, die sich im Sommersemester 1989 vor dem Seminarraum in der „Neuen Mensa“ einfanden – einige getrieben vom Willen zum Wissen, andere angespült vom Wunsch zu lernen, manche schon zielstrebig auf Identitätssuche, wieder andere noch mit dem Schrecken der Verirrten im Gesicht und mitten in der Raumorientierungsphase. „Einführung in das Projektstudium“, so hieß eine der Pflichtveranstaltungen im Studium der Kulturanthropologie und Europäischen Ethnologie an der Goethe-Universität – 1989 noch basisnah „in“ Frankfurt am Main. Seminarleitung: Gisela Welz. Wir, Erst- und Zweitsemester, hatten schon von ihr gehört – das Institut war klein und sendungsbewusst genug, um die herrschende Ordnung der Dinge dort in ihren wesentlichen Zügen rasch zu vermitteln: Gisela Welz war so etwas wie der allseits hoch geachtete Kopf der U 21 des Instituts. Dennoch gab es Überraschendes.
Gemessen am insgesamt extrovertiert bis kapriziös anmutenden Habitus, wie er damals am Institut gelebt, zelebriert und in der Person von Institutsleiterin Ina-Maria Greverus einzigartig verkörpert wurde, war die Atmosphäre in Giselas Seminaren eine echte Abwechslung: Gemessenen Schrittes, in wadenlangem Glockenrock und weißen Söckchen betrat sie den Raum und nahm am Pult Platz. Dann führte sie uns mit wissensbasierter Umsicht und Gelassenheit in leisem Ton ins Projektstudium ein. Viele Worte machte sie dabei nicht, Kommentare und Anmerkungen waren rares Gut, doch jeder Satz von Gisela war ein Solitär, dessen geschliffene Schönheit und Präzision uns aufhorchen ließ. Während wir dieser ästhetischen Erfahrung gespannte und gebührende Aufmerksamkeit zollten, ließ sich auf moralischem Terrain Tauwetter genießen – durchaus ungewöhnlich zu einer Zeit, in der die Kenntnis vermeintlicher äußerer Feinde zum curricularen Kanon gehörte.
Bei Gisela waren wir also „bei der Sache“, und unter ihrer wohltemperierten Leitung probten wir unsere ersten wissenschaftlichen Fingerübungen und Flugstunden, verbrachten – angestrengt teilnehmend beobachtend – einen Abend in der „Batschkapp“, führten Feldtagebücher, verfassten Exzerpte und kleine Forschungsberichte. Bei diesen Gelegenheiten kamen wir in Berührung mit einer Sonderheit wissenschaftlichen Schreibens: der Fußnote. Ihren wesentlicher Sinn und Zweck erfassten wir rasch: War es durch sie doch möglich einen Verweisungszusammenhang herzustellen, an weiterführende Fragen und Diskusionen anzuknüpfen und das Eigene dort, wo man sich am Ende glaubte, anschlussfähig zu machen. Oder es als solches zu präsentieren – dies begriffen wir intuitiv und noch vor unserer Bekanntschaft mit der dazugehörigen wissenschaftlichen Debatte. Fußnoten waren also eine gute und wichtige Sache, und so machten wir uns daran, unsere Texte wissenschaftlich aufzubrezeln und kulturtechnisch versiert im Diskurs mitzumurmeln.[1] Dabei lauerte im Schatten dieser redlichen, ja edlen, dem Fortkommen Vieler und dem Wissen als sozialem Gut verpflichteten Praxis das unangenehme Gefühl, dem angestrebten Verweisungszusammenhang in Zahl, Weite und Qualität nicht (immer) gewachsen zu sein. Es gab einfach viel zu viele Gelegenheiten für dieses unschuldige kleingedruckte Monster mit seinem hehren Anspruch, hier noch mehr und dort noch weiter zu lesen und zu denken und zu schreiben… War das zu schaffen? Was tun?
Wenn man sich lesend umsah, gab es da verschiedene Umgangsweisen mit Fußnoten im schillernd-schwülen Dunstkreis der Wissenschaft, in dem (Noch)(-)(Nicht-)Wissen, Dazu-gehören-Wollen, Status und Selbstbewusstsein sich tummeln. So mancher Text entledigt/e sich des Problems ganz konkret, in dem Fußnoten nur spärlich bis gar nicht auftauchten – was je nach Maß der thematisch-inhaltlichen Durchdringung und Brillanz souverän oder unbedarft anmuten konnte. Wer sich als Studierende/r die Souveränität (noch) nicht zutraute und Unbedarftheit fürchtete – das waren freilich nicht alle – für den war dies keine Option. Interessanter schien da so etwas wie der „vage Verweis“. Er war handlich und unaufwändig und funktionierte vorrangig assoziativ: An (in der Community anerkannte) Begriffe fügte man die Namen der üblichen Verdächtigen, manchmal auch mehrfach den gleichen, da es unter herrschenden Bedingungen bei der wissenschaftlichen Schreibproduktion verlässlich zu Wiederholungstaten kommt. An (anerkannte) Namen wiederum fügte man Sätze wie „Zum Begriff der instrumentellen Raumaneignung vgl. Greverus 1978“ oder später: „Zum Begriff der kulturellen Hybridität vgl. Said 1978, Spivak 1988, Bhaba 1994“ in die Fußnote. Als ein vager Verweis ließ der Verweis offen, ob und welches Wissen in der Fußnote geborgen – oder im Hegelschen Sinn aufgehoben war. [2]
Anders bei Gisela. Ihre Dissertation Street Life[3] erschien in meinem zweiten Studienjahr, 1991. Stattliche 485 Seiten, 63 davon Fußnoten, verdichtet in Times New Roman 8 Punkt.[4] In meinem Umfeld lasen wir alle ihr Buch und mit Gewinn, aber wirklich fertig wurden wir damit nicht. 852 Fußnoten, keine davon wies vage ins Weite, keine ein heiter-unbestimmtes Gewedel ins Irgendwo. Giselas Fußnoten waren allesamt substanziell, drall und ergiebig, eine jede eine Startbasis, viele ein Spaceshuttle, manche eine eigene Raumstation. Bis in heutige Tage finde ich in diesen Fußnoten (und dem, was folgte J) jede Menge Anregung und Hinweise.
Da war sie also, die zivilisatorische Grenze, die Frontier der Fußnoten, die das als frei verkleidete Wilde zurückwies und den Kulturtechniker*innen des vagen Verweisens die Wangen färbte. Aus meinem Nebenfach Frankfurter Prägung wusste ich, dass, wer die Grenze überschreitet, sie setzt. Stimmt, dachte ich, und griff – während gerade die „Globalisierung“ uns Orte und Plätzchen streitig zu machen begann – trostsuchend nach den Exilen der Heiterkeit.[5]
Doch
für kulturelle Wesen und andere manifeste Cyborgs[6] besteht
ja interpretativer Spielraum, und für unverdrossen Weiterlernende sogar noch
Hoffnung. Es gäbe nichts, was gut sei, außer dem guten Willen, rief mir wenig
später ein beeindruckter Sterngucker aus ferner Zeit zu, und bot mir obendrein
an, die Grenze zur regulativen Idee umzudekorieren.[7] Gerne,
ja erleichtert nahm ich an und Abschied vom Prinzipiellen[8] und las
und lernte weiter aus Giselas Texten und hole mir bis heute mit Bewunderung,
Dankbarkeit und Sympathie Verweise in Hülle und Fülle ab. Es ist ein bisschen
wie Baden im Bälleparadies: Man kann man sich aus verschiedenen guten Gründen
abholen lassen, freut sich aber immer wieder auf das nächste Mal.
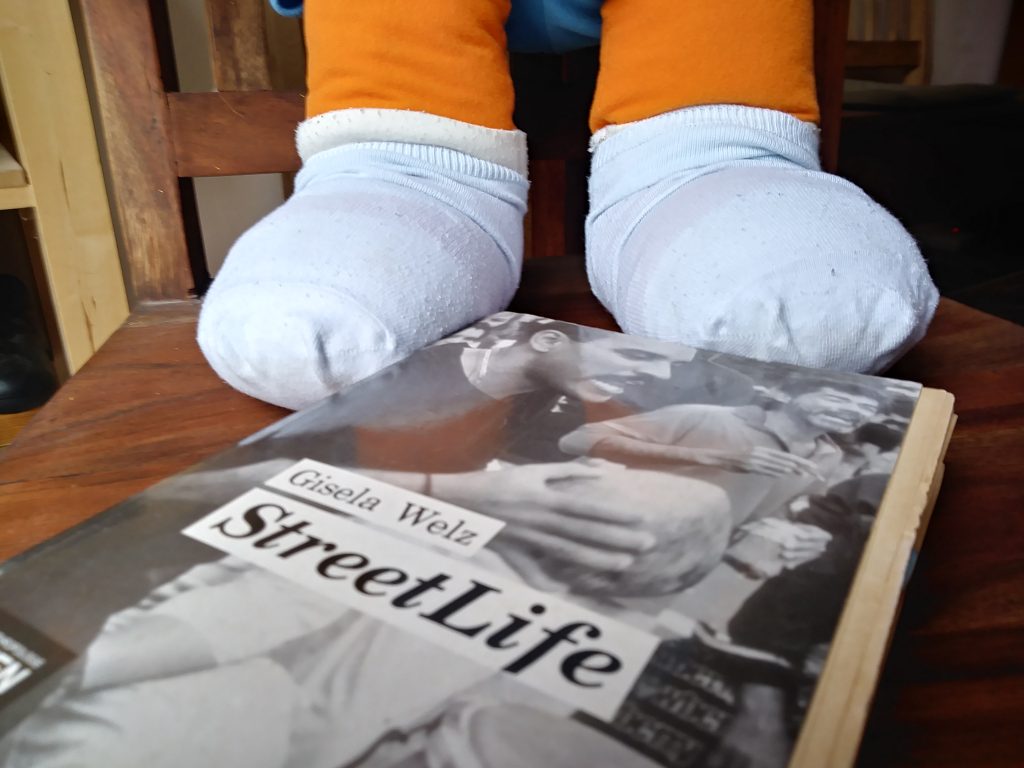
[1] Vgl. Foucault, Michel (1970): Die Ordnung des Diskurses; Antrittsvorlesung 1970. Hier: Frankfurt am Main: Suhrkamp 1991
[2] Vgl. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Phänomenologie des Geistes 1807, hier: Suhrkamp:1986
[3] Welz, Gisela (1991): Street Life. Alltag in einem New Yorker Slum, Frankfurt am Main: Kulturanthropologie-Notizen, Band 36
[4] „Street Life“ hat fünf große Kapitel: 1. Street Life als Forschungsgegenstand – 219 Fußnoten; 2. Street Life als Bedürfnisdeckungsstrategie – 231 Fußnoten; 3. Street Life als soziale Organisation des Raumes – 177 Fußnoten; 4. Street Life als politisches Handeln – 221 Fußnoten und 5. Street Life: Eine anthropologische Interpretation kultureller Praxis – enttäuschende 9 Fußnoten.
[5] Marquard, Odo (1976): Exile der Heiterkeit, in: Poetik und Hermeneutik. Das Komische, hrsgg. von Wolfgang Preisendanz und Rainer Warning, München: Wilhelm Fink Verlag
[6] Haraway. Donna: Ein Manifest für Cyborgs (1985), hier in: Monströse Versprechen, Hamburg: Argument-Verlag, 2017
[7] Kant, Immanuel: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, (1797); hier: Kants Werke, Band IV, Berlin: de Gruyter 1968
[8] Marquard, Odo (1995): Abschied vom Prinzipiellen, in: Abschied vom Prinzipiellen, Stuttgart: Reclam

