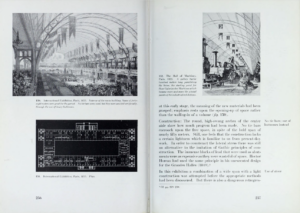Impressionismus und Glasarchitektur im 19. Jahrhundert
Der Crystal Palace der Londoner Weltausstellung von 1851, das erste konsequent und im großen Stil ausgeführte Glas-Eisen-Gebäude, und das Palais de l’Industrie der Pariser Ausstellung von 1855 stellten architektonisch einen ähnlichen Wahrnehmungsschock her wie die ersten Eisenbahnreisen. »Die ungeheuren Glasflächen der Überdachung«, so gibt Giedion die zeitgenössische Reaktion wieder, »blendeten die damaligen Besucher, die an diese überraschende Lichtfülle nicht gewöhnt waren. […] Die Wahrnehmung des Raumes des Crystal Palace […] möchte man aufgrund der Verselbständigung des Lichtes sowie der Auflösung der Gegenständlichkeit, die sie charakterisieren, impressionistisch nennen.«
Schivelbusch 1995, S. 46, 48
Abb 1. Siegfried Giedion, Space, Time and Architecture. The Growth of a New Tradition, 3 erweiterte Ausgabe, Cambridge 1959
In Space, Time and Architecture beschreibt der Architekturhistoriker Siegfried Giedion den Eindruck der Besucher der Londoner Weltausstellung von 1851 als „märchenhaft“ – ausgelöst durch eine neuartige Glasarchitektur in Faltdachkonstruktion, die aufgrund ihrer empfundenen Leichtigkeit als Traumwelt wahrgenommen wurde.[1] Es besteht eine grundsätzliche Analogie zwischen der Wirkung impressionistischer Malerei und der im 19. Jahrhundert entstehenden Glasarchitektur. Besonders die Wahrnehmung stilistischer Merkmale des Impressionismus, wie der Auflösung von Gegenständlichkeit, das Einfangen eines flüchtigen und fragilen Momentes, der von bestimmten äußeren Faktoren wie etwa sich verändernder Lichtverhältnisse abhängig ist, das Schwebe-Gefühl von vermeintlich materiellen Objekten und der Flächigkeit im Bild, die durch das Fehlen von Licht-Schatten-Kontrasten verursacht wird, bezieht Giedion auf die architektonische Gestaltung der neuen Glas-Eisen-Konstruktion im Kristallpalast. Diese zeichnet sich in erster Linie durch eine platzsparende Bauweise aus, die aufgrund ihrer lichtdurchlässigen Eigenschaft von Glas ermöglicht, dass größere Lichtmengen in den Raum gelangen können.
Die Wahrnehmung von Licht, die im Impressionismus zentral ist, verändert sich grundlegend. Eine präzise Beschreibung des zeitgenössischen Eindrucks gibt der Londoner Emigranten Lothar Bucher: „Wir sehen ein feines Netzwerk von Linien, aber ohne irgendeinen Anhalt, um eine Vorstellung der Entfernung vom Auge und der wirklichen Größe zu gewinnen. Die Seitenwände stehen zu weit ab, um sie mit demselben Blick umfangen zu können, und anstatt über eine gegenüberliegende Wand streift das Auge an einer unendlichen Perspektive hinauf, die im Dunst verschwindet. Wir wissen nicht, ob das Gewebe hundert oder tausend Fuß über uns schwebt, ob die Decke flach oder durch eine Menge kleiner Dächer gebildet ist, denn es fehlt ganz an dem Schattenwurf, der sonst der Seele die Eindrücke des Sehnervs verstehen hilft. Lassen wir den Blick langsam wieder hinabgleiten, so begegnet er den durchbrochenen, blau bemalten Trägern, anfangs in weiten Zwischenräumen, dann immer näher rückend, sich deckend, dann unterbrochen durch einen glänzenden Lichtstreifen – das Querschliff -, endlich in einem fernen Hintergrund verfließend, in dem alles Körperhafte verschwindet… Es ist nüchterne Ökonomie der Sprache, wenn ich den Anblick des gewölbten Querschliffes unvergleichlich, märchenhaft nenne. Es ist ein Stück Sommernachtstraum in heller Mittagssonne“.[2]

Buchers Beschreibung aufgreifend vergleicht Giedion den illusionistischen Eindruck, der Raum und Material bei der Glasarchitektur hervorruft, mit der Wahrnehmung des Aquarells Simplonpaß von J.M.W. Turner (1775–1851). Das Gemälde erreicht „die Entmaterialisierung der Landschaft und ihre Auflösung im Unendlichen durch die Darstellung einer feuchten Atmosphäre. Der Kristallpalast erreicht die gleiche Wirkung mittels durchsichtiger Glasflächen und konstruktiver Elemente. Im Gemälde von Turner sind die Mittel weniger abstrakt, aber ein gleichwertiger, entmaterialisierter und schwebender Eindruck wird damit hervorgerufen. Die tiefen Bergschluchten – in Grau, Braun und Blau – und der gelblich-braune Pfad, der sich auf die Anhöhen windet, erreichen die Eliminierung jeglicher naturalistischer Andeutung: sie scheinen geradezu als Bestandteil einer Traumlandschaft in »heller Mittagssonne gesehen« zu sein.“[3]
Text: Yunus Emrah Fazlioglu
Anmerkungen
Sämtliche Zitate sind der deutschen Ausgabe aus dem Jahr 1965 entnommen (siehe Fußnoten). Der Titel der Erstausgabe lautet: Siegfried Giedion, Space, Time and Architecture. The Growth of a New Tradition, Cambridge 1941, Digitalisat der 3. Ausg.: URL: https://monoskop.org/log/?p=11402
[1] Giedion, Siegfried: Raum, Zeit, Architektur. Die Entstehung einer neuen Tradition, Ravensburg 1965, S. 179.
[2] Giedion 1965 (wie Anm. 1), S. 181–183.
[3] Giedion 1965 (wie Anm. 1), S. 183.
Bildnachweis:
Abb. 1 Siegfried Giedion, Space, Time and Architecture. The Growth of a New Tradition, 3 erweiterte Ausgabe, Cambridge 1959, URL: https://monoskop.org/log/?p=11402, letzter Zugriff:
29.01.2024
Abb. 2 Joseph Mallord William Turner: Simplon Pass, ca. 1850, Wasserfarbe und Gouache auf Papier, 38 x 55,2 cm, Cambridge (Fogg Art Museum / Schenkung von Edward W. Forbes 1954), Objektnummer: 1954.133, URL: https://harvardartmuseums.org/collections/object/294082 (Digitale
Sammlung des Fogg Art Museum in Cambridge), letzter Zugriff:
29.01.2024
Das panoramatische Reisen und das Lob der Fläche in der Malerei C.D. Friedrichs
Dolf Sternberger verwendet den Begriff des Panorama und des Panoramatischen, um die europäische Wahrnehmung im 19. Jahrhundert zu beschreiben, ihre Tendenz, das Unterschiedliche unterschiedslos zu sehen. »Die Ausblicke aus den europäischen Fenstern«, sagt Sternberger, »haben ihre Tiefendimension vollends verloren, sind nur Teile einer und derselben Panoramenwelt geworden, die sich ringsumher zieht und überall nur bemalte Fläche ist.
Schivelbusch 1995, S. 60.

Ein ähnliches Gefühl der Verlorenheit und Überforderung, wie einige Reisende beim Blick aus den Fenstern der ersten Eisenbahnen verspürten, hat auch ein berühmter Zeitgenosse beim Betrachten von Caspar David Friedrichs Mönch am Meer empfunden: Heinrich von Kleist bemerkte, man fühle sich, als „ob einem die Augenlider weggeschnitten wären“[1] und spielt damit auf die panoramatische, gleichzeitig zum Sehen auffordernde, aber auch die Immersion bewusst verwehrende Gestaltung des Gemäldes an.[2] So scheinen das Format (1,1 x 1,71 m)[3] und auch die scheinbar über den Bildraum hinausgehende Küstenlinie[4] die Betrachtenden konfrontativ, fast schon „brutal“[5], zur Immersion einzuladen, die abstrakten-unverbundenen Elemente und die unklare Betrachterposition machen aber sowohl die Immersion als auch eine Fokussierung des Blickes unmöglich.[6] Börsch-Supan spricht aufgrund der fehlenden Tiefe der Darstellung von „angestrengte[m] und dennoch sinnlose[m] Bemühen, möglichst viel von dieser Unendlichkeit zu fassen“[7], scheint doch das Wasser flächig und der Himmel wie eine „Wand“, die sich vor den Betrachtenden aufbaut,[8] die Landschaft scheint so fast wie eine Montage. Grave sieht hier eine gewollte Betonung der Materialität, der Gemachtheit des Bildes durch Friedrich, der sich eben nicht dem damals geltenden Ideal der Landschaftsmalerei beugt: Die Landschaft sollte nach der zeitgenössischen Meinung optimalerweise eine Illusion bieten, in die die Betrachtenden gleichsam eintreten können sollten.[9] Die Zweigeteiltheit des Bildes – zwischen Immersion und Abstoßen des Betrachters – fordert, so Börsch-Supan, gleichsam „zweierlei Arten des Sehens“[10]: Den Vordergrund könnten die Betrachter relativ gewohnt wahrnehmen und erkennen, vom Hintergrund allerdings würde der Blick „überwältigt“ werden.[11] Dabei ergibt sich ein gegensätzliches Bild zur Wahrnehmungserfahrung beim Blick aus dem Zugfenster: Hier sind es die vordergründigen Elemente, die durch die Geschwindigkeit verschwimmen, einzig Objekte in weiterer Entfernung können genauer erfasst werden.[12]

Dabei ist es interessant, dass vor allem in Friedrichs früheren Werken, wie dem Wanderer über dem Nebelmeer, den Betrachtenden noch mehr Möglichkeit zur Immersion oder zumindest zum Verständnis des Landschaftsraumes gegeben wurde: Durch zentrale Rückenfiguren wird dabei den Betrachtenden eine klare Position zugewiesen und somit der Ausgangspunkt des Blickes definiert.[13] Die Landschaft im Mönch am Meer ist, wie für die Eisenbahnreisenden die Landschaft bei der Fahrt, für die Betrachtenden ausschließlich als unterschiedsloser-gleichförmiger Einheitsraum[14] wahrnehmbar: Bei der Zugfahrt ist den Blickenden eine klare Verortung im Raum unmöglich durch die „Reizflut“[15] und die durch die Geschwindigkeit verschwimmenden Bilder, in Friedrichs Gemälde sind es die nicht klar definierte Position des Betrachtenden und die scheinbar endlose Panorama-Ansicht der Landschaft, die diesen Effekt haben.
Text: Amelie Trummer
Anmerkungen
[1] Kleist, Heinrich von: Empfindungen vor Friedrichs Seelandschaft, in: Berliner Abendblätter, 12. Blatt (13. Oktober 1810), o. S.
[2] Vgl. Mathias, Nikita: Between Immersion and Media Reflexivity. Virtual Travel Media in the 19th Century, in: International Journal of Film and Media Arts, 1.2 (2016), S. 24.
[3] Vgl. ebd. und Börsch-Supan, Helmut: Bemerkungen zu Caspar David Friedrichs „Mönch am Meer“, in: Zeitschrift des Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft, 19 (1965), S. 63.
[4] Vgl. ebd. und ebd.
[5] Jensen, Jens Christian: Caspar David Friedrich. Leben und Werk, Köln 1974, S. 109.
[6] Vgl. Börsch-Supan 1965 (wie Anm. 3), S. 64 und Grave, Johannes: Caspar David Friedrich, München [u.a.] 2012, S. 203f.
[7] Börsch-Supan 1965 (wie Anm. 3), S. 64.
[8] Vgl. ebd.
[9] Vgl. Grave, Johannes: Illusion und Bildbewusstsein. Überraschende Konvergenzen zwischen Goethe und Caspar David Friedrich, in: Jochen Golz, Albert Meier und Edith Zehm (Hrsg.): Goethe-Jahrbuch (Goethe-Jahrbuch, 128), Göttingen 2011, S. 108.
[10] Börsch-Supan 1965 (wie Anm. 3), S. 64.
[11] Vgl. ebd., S. 65.
[12] Vgl. Schivelbusch, Wolfgang: Geschichte der Eisenbahnreise. Zur Industrialisierung von Raum und Zeit im 19. Jahrhundert, Frankfurt am Main 1989 [EA 1977], S. 55.
[13] Wenngleich sich der Betrachter doch nicht mit der Rückenfigur identifizieren kann. Grave verweist in diesem Kontext auf die starke Individualität dieser Figuren, die ein Gleichsetzen mit dem Betrachter verhindern würden, und spricht, wie schon Niklas Luhmann, vielmehr von einer „Beobachtung zweiter Ordnung“ (S. 205), d.h. beim Ansehen des Gemälde wohne der Betrachter/die Betrachterin vielmehr „dem Sehen eines anderen [des Wanderers] bei“(S. 205). Vgl. Grave 2012 (wie Anm. 6), S. 203 und 205.
[14] Vgl. Schivelbusch 1989 (wie Anm. 12), S. 59.
[15] Ebd., S. 57.
Literatur
Börsch-Supan, Helmut: Bemerkungen zu Caspar David Friedrichs „Mönch am Meer“, in: Zeitschrift des Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft, 19 (1965), S. 63–76.
Grave, Johannes: Illusion und Bildbewusstsein. Überraschende Konvergenzen zwischen Goethe und Caspar David Friedrich, in: Jochen Golz, Albert Meier und Edith Zehm (Hrsg.): Goethe-Jahrbuch (Goethe-Jahrbuch, 128), Göttingen 2011, S. 107–126.
Grave, Johannes: Caspar David Friedrich, München [u.a.] 2012.
Jensen, Jens Christian: Caspar David Friedrich. Leben und Werk, Köln 1974.
Kleist, Heinrich von: Empfindungen vor Friedrichs Seelandschaft, in: Berliner Abendblätter, 12. Blatt (13. Oktober 1810), o. S.
Mathias, Nikita: Between Immersion and Media Reflexivity. Virtual Travel Media in the 19th Century, in: International Journal of Film and Media Arts, 1.2 (2016), S. 22–33.
Schivelbusch, Wolfgang: Geschichte der Eisenbahnreise. Zur Industrialisierung von Raum und Zeit im 19. Jahrhundert, Frankfurt am Main 1989 [EA 1977].
Abbildungen
Abb. 1 Caspar David Friedrich: Mönch am Meer, 1808-1810, Öl auf Leinwand, 110 x 171, 5 cm, Berlin (Alte Nationalgalerie / Fotografie von Andres Klinger / 1810 Kauf durch Kronprinz Wilhelm von Preußen, Besitz der Krone. 1928 – 1957 Staatliche Schlösser und Gärten, Berlin. Seit 1957 Eigentum der Staatlichen Museen Preußischer Kulturbesitz),
Ident. Nr.: NH 9 / 85, URL: https://recherche.smb.museum/detail/965511/m%C3%B6nch-am-meer (Digitale Sammlung Alte Nationalgalerie), letzter Zugriff: 11.02.2024.
Abb. 2 Caspar David Friedrich: Wanderer über dem Nebelmeer, ca. 1817, Öl auf Leinwand, 94,8 x 74,8 cm, Hamburg (Hamburger Kunsthalle / Fotografie von Elke Walford / Dauerleihgabe der Stiftung Hamburger Kunstsammlungen seit 1970), Inv. Nr.: HK-5161, URL: https://online-sammlung.hamburger-kunsthalle.de/en/objekt/HK-5161
(Digitale Sammlung Hamburger Kunsthalle), letzter Zugriff: 30.01.2024.
Eisenbahnraum und Eisenbahnzeit und der Verlust der Aura
Den Landschaften, die durch die Eisenbahn zusammengeschlossen bzw. an die Hauptstadt angeschlossen, und den Waren, die durch den modernen Transport aus ihrer lokalen Verbundenheit gerissen werden, ist gemeinsam, daß sie ihren angestammten Platz, ihr überliefertes Hier und Jetzt, mit einem begriff Walter Benjamins, ihre Aura verlieren.
Schivelbusch 1995, S. 42
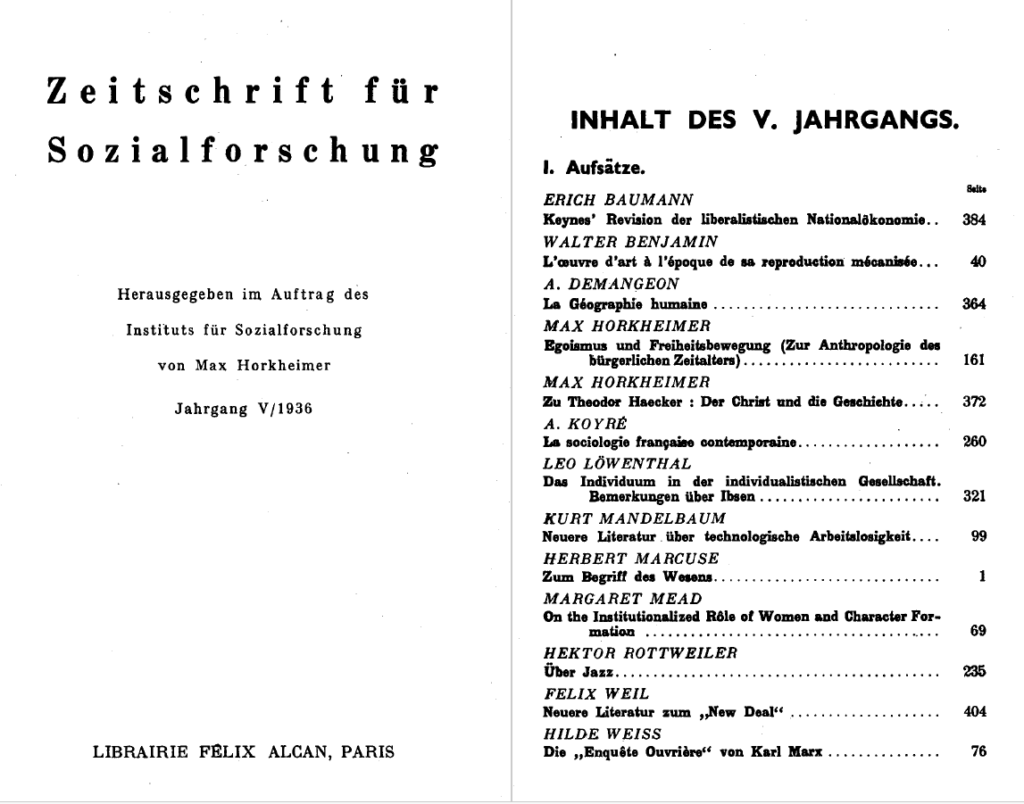
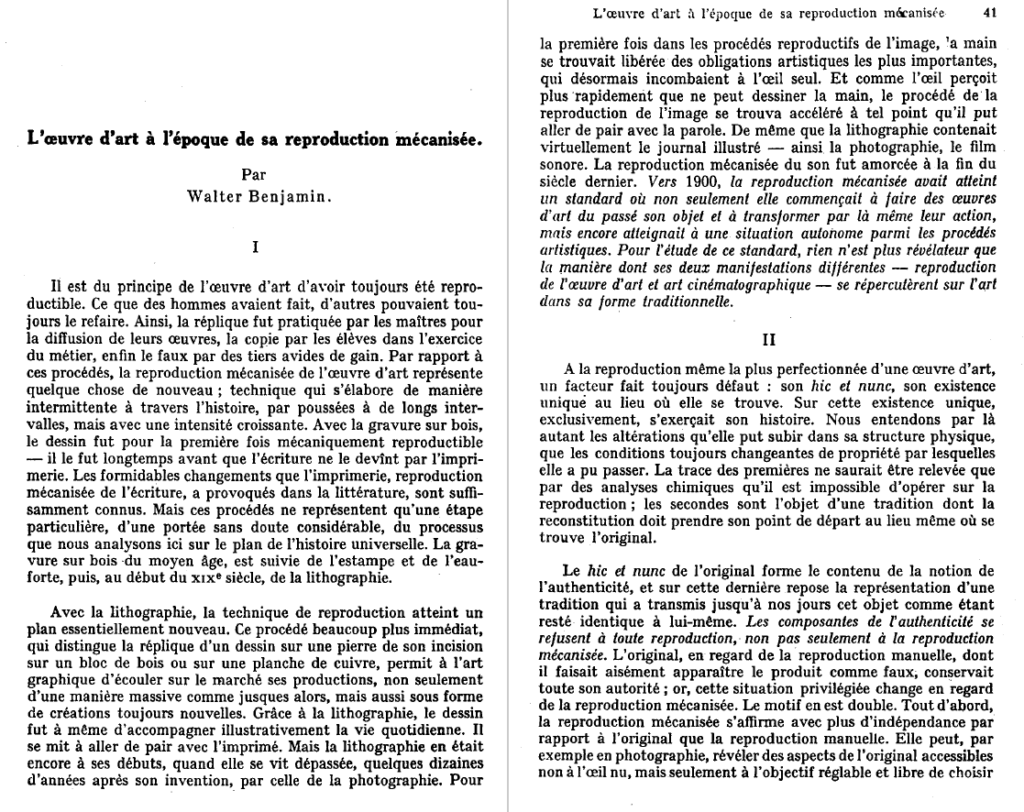
Walter Benjamin führt in Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit (1935) den Begriff der „Aura“ eines Kunstwerkes ein und definiert deren Verlust in Folge der technischen Reproduzierbarkeit des Kunstwerkes. Die Frage „Was ist eigentlich Aura?“ beantwortet Benjamin folgendermaßen: „Ein sonderbares Gespinst aus Raum und Zeit: einmalige Erscheinung einer Ferne, so nah sie sein mag.“ (Benjamin 1989, S. 440). Die Aura des Kunstwerkes konstituiert sich unter anderem über das „Hier und Jetzt“ des Originals, d. h. „sein einmaliges Dasein an dem Orte, an dem es sich befindet“ (Benjamin 1989, S. 437). Damit einher geht der Begriff der „Echtheit“ des Kunstwerkes, also die Vorstellung der räumlich-zeitlichen Einmaligkeit des Originals. Die technische Reproduktion vervielfältigt das Reproduzierte und setzt damit „an die Stelle seines einmaligen Vorkommens sein massenweises“ (Benjamin 1989, S. 438), greift also die Einmaligkeit an. Zudem bringt die technische Reproduktion das Original an „andere Orte“ (Benjamin 1989, S. 438), beispielsweise lässt sich die Aufnahme eines Konzertes im eigenen Zimmer anhören. Schivelbusch überträgt Benjamins Begriffe auf das veränderte Verhältnis zu Landschaft und Entfernungen in Folge des Eisenbahnausbaus im 19. und 20. Jahrhundert. Landschaften und Waren verlieren laut Schivelbusch durch die Erschließung des Landes mittels der Eisenbahn ihre Aura. Das Hier und Jetzt von Waren und Landschaft wird durch die erleichterte Zugänglichkeit angetastet und entwertet. Landschaften stehen mit der Eisenbahnreise nicht mehr isoliert und abgeschlossen (also räumlich-zeitlich einmalig), sondern lassen sich „massentouristisch“ erschließen (Schivelbusch 1995, S. 43). Diese Landschaften werden den Massen des 19. Jahrhunderts „näher“ gebracht:
Die Dinge sich »näherzubringen« ist nämlich ein genau so leidenschaftliches Anliegen der gegenwärtigen Massen wie es ihre Tendenz einer Überwindung des Einmaligen jeder Gegebenheit durch deren Reproduzierbarkeit darstellt.
Benjamin 1989, S. 440
Dieses Näherbringen der Landschaften durch die Eisenbahn begreift Schivelbusch als Vorstufe der Verfügbarmachung von Einzigartigkeit durch Reproduktion. Zudem begreift Schivelbusch die Auflösung von räumlichen Distanzen ebenfalls als Vorbereitung der Auflösung der Unterschiede zwischen Original und Abbild. Auch der Warentransport versetzt Waren als Produkte physisch an andere Orte, entfernt sie aus ihrer „lokalen Verbundenheit“ und macht sie verfügbar, so wie die technische Reproduktion eine Zugänglichkeit zum Kunstwerk schafft, die nicht an Lokalitäten gebunden ist.
Benjamin selbst geht auf die Entwertung des Hier und Jetzt von Landschaften durch die Reproduktionstechnik des Films ein. Allerdings spricht er der Natur eine andere Form der Echtheit zu, eine, die nicht so verletzbar ist, wie die der Kunst:
Diese veränderten Umstände [Selbständigkeit gegenüber dem Original und Entlokalisierung; Anm. d. Verf.] mögen im übrigen den Bestand des Kunstwerkes unangetastet lassen – sie entwerten auf jeden Fall das Hier und Jetzt. Wenn das auch keineswegs vom Kunstwerk allein gilt sondern entsprechend zum Beispiel von einer Landschaft, die im Film am Beschauer vorbeizieht, so wird durch diesen Vorgang am Kunstwerk doch ein empfindlichster Kern berührt, den so ein Gegenstand der Natur nicht aufweist. Das ist seine Echtheit.
Benjamin 1989, S. 438
Text: Ruth Lindner
Literatur
Benjamin, Walter: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit [Erste Fassung], in: Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser (Hrsg.): Gesammelte Schriften / Walter Benjamin. Unter Mitw. von Theodor W. Adorno und Gershom Scholem hrsg. von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser, Frankfurt am Main 1989, S. 435–467.
Schivelbusch, Wolfgang: Geschichte der Eisenbahnreise. Zur Industrialisierung von Raum und Zeit im 19. Jahrhundert, Frankfurt am Main 1989 [EA 1977].