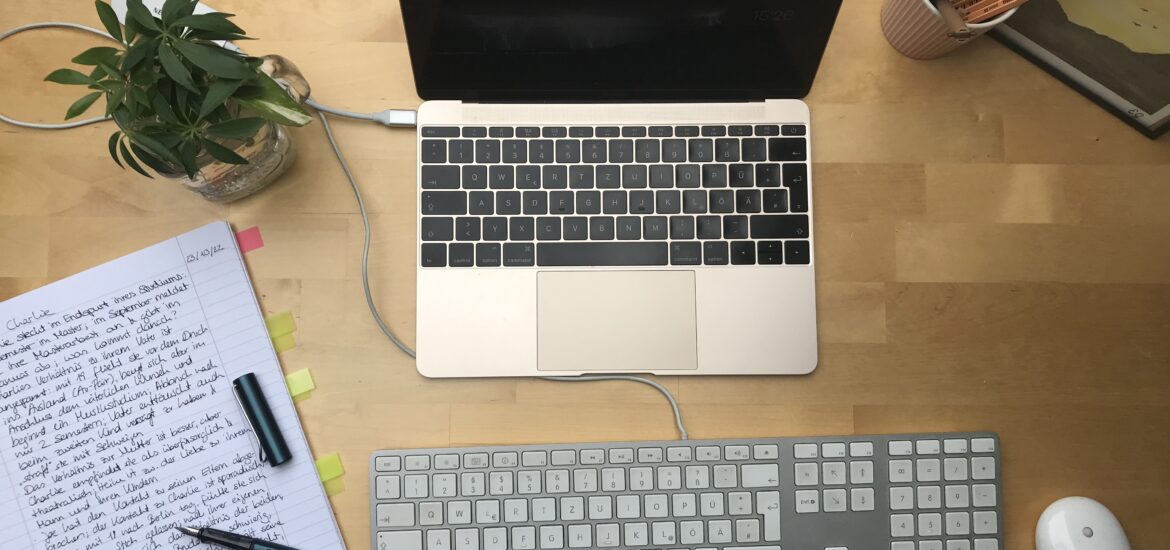Vor fast zwei Jahren habe ich hier auf dieser Plattform davon berichtet, dass ich Schriftstellerin werden möchte und dass ich endlich den Mut gefasst habe, diesen Traum aktiv zu verfolgen. Seitdem ist viel passiert in meinem Leben. Vor allem in den vergangenen zwölf Monaten habe ich viel dazugelernt und über mein Schreiben reflektiert. Dabei sind mir zwei zentrale Herausforderungen aufgefallen.
Die erste ist meine Angst. Hohe Ansprüche an mich selbst und das ständige Vergleichen mit anderen führt dazu, dass ich häufig gar nicht erst anfange mit dem Schreiben oder dass ich im Nachhinein unzufrieden bin. Doch was genau mich davon abhält, einfach zu schreiben, ohne mir Gedanken über die „Qualität“ des Ergebnisses zu machen, verstand ich erst im letzten Oktober. Doris Dörrie öffnete mir die Augen, als ich ihr Buch „Leben, schreiben, atmen“ (2019) las. Darin plädiert sie vor allem für das autobiografische Schreiben. „Wir sind alle Geschichtenerzähler“ und „jedes Schreiben [ist] in einem gewissen Maß kreativ“. Um sich dabei nicht an Formulierungen aufzuhängen, lautet der Leitsatz: Blödsinn schreiben. Damit ist gemeint, dass es nicht darum geht, „Verwertbares zu schreiben, ein Produkt herzustellen, das sich verkauft, oder Literaturpreise zu gewinnen, sondern darum, aufmerksam und vorurteilsfrei dem eigenen Gehirn zuzuschauen und zuzuhören.“
Schreiben als Prozess und nicht als Ergebnis.
Natürlich ist meine Angst nicht plötzlich verschwunden, als ich mir all das bewusst machte. Aber ich rufe mir immer wieder ins Gedächtnis, dass es okay ist, einfach nur zu schreiben; dass man sich nicht am „perfekten“ Wort oder Ausdruck aufhängen muss, dafür ist später noch genug Zeit.
Die zweite Herausforderung ist mein Arbeitsprozess. Das wurde mir bereits im letzten Frühjahr bewusst, als ich begann, ein fertiges Romanprojekt zu überarbeiten, von dem ich bereits in meinem Beitrag im Sommer 2021 berichtete. Damals lautete mein Ziel: etwas schreiben und es beenden. Vier Monate später hatte ich diesen Roman beendet, aber irgendetwas stimmte nicht. Der Geschichte fehlte der rote Faden und sie „plätscherte“ so vor sich hin, ohne auf ein konkretes Ziel zuzusteuern. Das ist im Hinblick auf meine Arbeitsweise auch nicht verwunderlich. Ich schreibe grundsätzlich sehr intuitiv. Sobald ich eine Idee habe, fange ich an zu schreiben. Und wenn ich nicht weiter weiß, überspringe ich einen Teil der Geschichte und schreibe an anderen Stellen. Das frühe Schreiben, also früh im Arbeitsprozess, ist für mich immer deshalb wichtig gewesen, weil ich erst dadurch ins Denken und Entwickeln von Ideen komme. Erst im tatsächlichen Schreiben entfalten sich Figuren und Handlung und somit war Planen im Voraus für mich lange ein scheinbar unüberwindbares Hindernis. Doch im Hinblick auf diesen „fertigen“ Roman wurde mir klar, dass ich mich nun endlich mit diesem Hindernis auseinandersetzen muss.
Die besten Ideen reifen über Zeit. Diese Beobachtung hatte ich beim Schreiben schon öfter gemacht, wenn ich einen älteren Text gefunden habe, an dem ich irgendwann nicht weitergekommen war. Beim erneuten Durchlesen Monate oder Jahre später, waren aber plötzlich ganz viele neue Ideen und Ansätze da. Nicht selten verwarf ich die komplette Handlung und fing nur mit den Figuren von vorne an. Im September erzählte ich einer Freundin von einer dieser Ideen, die seit mehreren Jahren auf meinem Computer und in meinem Hinterkopf vor sich hin wuchern, mal mehr mal weniger schnell. Beim Erzählen merkte ich, wie viele Gedanken ich mir dazu schon gemacht hatte, wie viel ich über meine Protagonisten wusste. Und als meine Freundin, der offenbar entgangen war, dass ich mir das alles ausgedacht hatte, fragte, wie das Buch hieß, wurde mir klar: diese Geschichte verdient es, erzählt zu werden. Und so setzte ich mich an meinen Schreibtisch und hielt handschriftlich alles fest, was ich zuvor erzählt hatte. Und beim Schreiben, obwohl nur in Stichpunkten, fing mein Gehirn an zu arbeiten.
Diese Erkenntnis, dass Schreiben nicht bedeutet, einen fertigen Text zu produzieren, dass ich meinen Denkprozess auch ins Rollen bringen kann, wenn ich nur Satzfetzen und Stichpunkte schreibe, änderte meine Einstellung zum Schreiben. Seitdem und auch wegen Doris Dörrie, die das Schreiben mit der Hand empfiehlt, halte ich Ideen immer regelmäßiger auf dem Papier fest. Ich lerne, mich von meiner Schönschrift zu trennen, um meiner Hand die Möglichkeit zu geben, mit meinen Gedanken Schritt zu halten.
All das erleichtert es mir, das Verfassen des Textes aufzuschieben. Ich notiere Ideen in Stichpunkten statt in Szenen und gebe ihnen Zeit zum Ausreifen und Wachsen. Noch immer hänge ich daran, eine Szene sofort schreiben zu wollen, und immer wieder gebe ich dem nach. Doch wenn die Planung soweit vorangeschritten ist, dass Route und Ziel abgesteckt sind, dann ist das auch in Ordnung. Es wird sicherlich Jahre dauern, bis ich diese neue Arbeitsweise verinnerlicht habe, aber allein die Erkenntnis, mit diesen wenigen „handwerklichen“ Kniffen so viel verändern zu können, ist viel Wert.
Und so habe ich vor zwei Wochen begonnen, den Roman neu zu schreiben. Noch einmal von vorne, allerdings von hinten aufgerollt. In ein mittlerweile zehnseitiges und stetig wachsendes Dokument trage ich nach und nach alles ein, was ich nach dem ersten Aufschreiben der Geschichte über meine Figuren weiß: wer sie sind, wer sie waren und wer sie sein möchten. Wo sie herkommen und wo sie hinwollen. Diese Notizen sind noch lange nicht vollständig und trotzdem beginne ich bereits, all diese Infos nach und nach in die Figurenkartei meines Schreibprogramms zu übertragen, das gerade bei der Planung solch umfangreicher Projekte hilfreich sein kann, um alles zu strukturieren. Wann dieser Roman dann so „richtig“ fertig ist, wird sich zeigen. Für den Moment zählt nur, dass ich vorankomme und dass die Geschichte mit jeder Idee, mit jedem Gedanken besser wird, auch wenn sie für den Anfang ungeschliffen in einer Textmasse an Notizen versinken.